|
Zwischen Park und Höhle.
Fakten: Studentisches Projekt an der ETH Zürich | Lehrstuhl Christian Kerez | 2003.
Architektur: Wolfgang Rossbauer.
Im
Zürcher Vorort Affoltern werden auf einer 30000 Quadratmeter
grossen Parzelle drei verglaste, geometrisch strenge Körper
in einem künstlichen Park zueinander konstelliert. Sie lehnen
sich in Dimension und Höhe an einige Affolterner Bauten aus
den 1960er Jahren an, bilden aber dennoch ein eigenständiges
Ensemble, das sich auf den üppigen, die Gruppe durchdringenden
Baumbestand bezieht und das vor allem - in der höhlenartigen
Räumlichkeit der einzelnen Baukörper - die Beziehung
mit dem eigenen Inneren sucht. Diese Arbeit beschäftigt sich
mit strukturell ähnlichen Themen wie die vorhergehende (Wohungen
am Gleisfeld, Zürich, Projekt 2001), das räumlich Entstandene
jedoch unterscheidet sich in jeder Hinsicht.
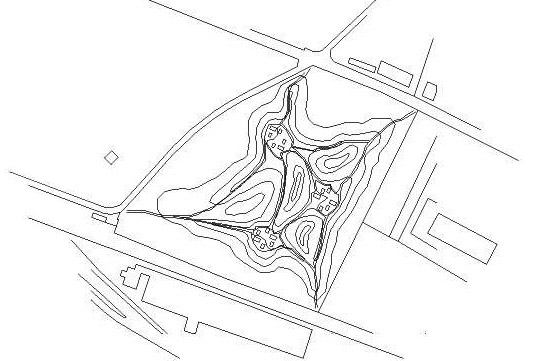
Jeder
Gebäudekörper
wird von einem pragmatisch gedachten System aus sechs Installations-
und Erschliessungskernen getragen, die zwei der vier Ecken eines
quadratischen Feldes halten. Die beiden anderen Ecken werden mit
Bodensprüngen so ausgearbeitet, dass sich einerseits ein
statisch sinnhaftes System ergibt und andererseits ein raumbestimmendes
Bodenrelief. Die zwei entworfenen Geschosse bilden in statischer
und räumlicher Hinsicht ein Abhängigkeitssystem. Die
Sprünge der Bodenplatte wirken als Träger, sie ermöglichen
weite Auskragungen. Die entstandenen Raumsequenzen genügen
mit ihren verschiedenen Höhen unterschiedlichen Nutzungsansprüchen
(z.B.: grosszügiger Eingangsbereich 2,70m; enger Durchgang
mit 2,40m; kontinuierliches Öffnen zur Ecke, Wohnen bis 3,10m)
und spannen ein landschaftliches Wohnfeld auf. Das darüber
und darunterliegende Geschoss einer Wohnung ist unmittelbar präsent,
der Abdruck der Räumlichkeit ist im Beton sichtbar und spürbar.
Die
beiden Wohnungen in jedem Geschoss werden von einer Wandlinie
getrennt, die die Erschliessungs- und Installationskerne so umspielt,
dass sie gleich einer endlos wirkenden, skulpturalen Abwicklung
erscheint. Die statische Ordnung wird verunklart und ist lokal
nicht mehr ablesbar - sie ist nur im Zusammenhang mit dem ganzen
Gebäude verständlich. Umgekehrt ist im Eingangsbereich
unter dem Gebäude die statische Grundordnung, die tragenden
Kerne, lesbar, das Deckenrelief bleibt als Abguss einer Raumidee
offen interpretierbar. Die Wohnräume folgen einem beinahe
archaischen Prinzip: Die verglaste Ecke ist einsehbar und gleichsam
öffentlicher Teil der Gebäudegruppe. Die sich ins Gebäudeinnere
windenden „Höhlen” werden zum Rückzugsort
der Wohnung. Der Ausblick ist hier nur in die Bäume möglich
und schliesst die anderen Gebäude aus.
Die
Gebäude sind strukturell bedingt in Stahlbeton ausgeführt,
der auch sichtbar gemacht wird. Die Oberflächen sollen die
Spuren des Benutzers im übertragenen Sinne zeigen. Die Deckenuntersicht
soll glänzend lasiert werden und so einen unnahbaren, entmaterialisierten
Charakter annehmen. Die Boden- und Wandoberflächen sollen
dem räumlichen Charakter des jeweiligen Ortes in der Wohnung
entsprechen, d.h. in den fassadennahen Bereichen glänzend
poliert und zu den Schlafzimmern hin einen unmerklichen Übergang
zu roherer Bearbeitung.
Die
Schalungen sind genau wie die Fassaden Bruchstücke einer
geometrischen Grossform. Sie setzen als sich immer ergebende Reststücke
den Guss als Ganzes zusammen. Die Vollverglasung wird von dünnen
schwarzen Stahlprofilen gefasst und „zerstrukturiert”
um den selbständigen Charakter - jedoch als Teil des Ganzen
- zu betonen.
Das
Relief der Bodenplatte ist ein übergeordnetes Prinzip, das
sowohl durch die statische Wirksamkeit, als auch durch die skulpturale
Bearbeitung die Multiplizierbarkeit der Wohnung ermöglicht.
Obwohl die Wohnung auf den ersten Blick das edle Unikat zu sein
scheint, wird es vervielfältigt gleich edlen Luxus-Massenartikeln
wie Prada oder Gucci. Ein pluralistisches Nebeneinander von individuellem
Anspruch und der Massenkultur eines bestimmten Lifestyles werden
in ein übersteigertes Spannungsfeld gesetzt.
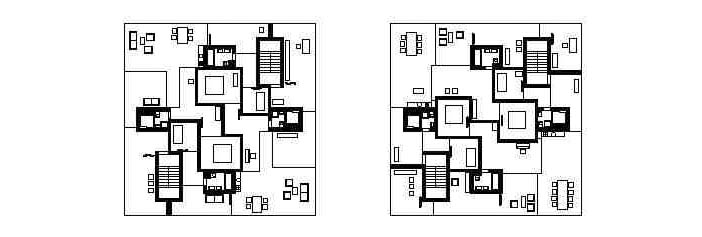
 Geschosse
A und B abwechselnd Geschosse
A und B abwechselnd

|